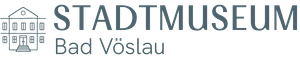Geschichte des Vöslauer Friedhofes
Friedhöfe sind seit Jahrhunderten zentrale Orte der Erinnerung und des Gedächtnisses. Der heute im deutschsprachigen Raum geläufige Begriff Friedhof meint einen umfriedeten Raum. Er entwickelte sich aus dem mittelalterlichen Kirchhof. Ursprünglich wurden die Toten nämlich in der Nähe der Kirche begraben. Als soziales Privileg galt eine Beerdigung direkt an der Kirchenmauer oder in einer Gruft in der Kirche – man denke an die Gruft der Grafenfamilie Fries in der Vöslauer Stadtpfarrkirche. Der allgemeine Bestattungsplatz war der Raum um das Gotteshaus, so wie das auch heute noch in vielen Dörfern der Fall ist.
Ein neuer Friedhof für Vöslau
Die Verlagerung der Friedhöfe an die Stadtgrenze, an den so genannten Gottesacker, hing mit dem immer stärker werdenden Hygienebewusstsein zusammen und auch mit dem Platzmangel innerhalb des Ortes. Anfang der 1860er wurde der Friedhof rund um die Kirche für die rapide wachsende Bevölkerung zu klein. Deshalb wurde seitens der Gemeinde Vöslau ein neuer Friedhof angedacht. Als eine der schwierigsten Aufgaben erwies sich dabei die Suche nach einer geeigneten Lage. Schließlich wurden von der eigens eingerichteten Friedhofcommission „zwei Grundstücke trockenes Ackerfeld in der Größe von 1600 Klafter“ (ca. 5.800 m²) angekauft. Auf Anordnung des k.k. Bezirksgerichtes Baden musste dieses mit einer „sechs Schuh hohen Mauer“ (ca. 1,90 m) eingefriedet werden.
Mehrere Pläne wurden eingereicht „und einer der besten für die Eintheilung der Gräber und die Anlagen angenommen“. Dieser Plan zeigt neben Baumgruppen und Sträuchern, zwischen entsprechend gruppierten Gräbern, inmitten des Friedhofes ein Kreuz. Dieses von Rosalie Freiin von Geymüller gestiftete Kreuz war früher am Kirchplatz aufgestellt. Es existiert heute noch, allerdings nicht mehr in der Mitte des Areals, denn der Friedhof wurde mehrmals erweitert und vergrößert.
Im Jahr 1866 wurde der neue Friedhof eröffnet und mit 1. September 1870 für vollendet erklärt. Allerdings stellte sich bereits drei Monate später heraus, dass eine Erweiterung dringend notwendig war, denn die Auflassung des alten Friedhofes stand zu diesem Zeitpunkt auch noch bevor.
Heute sieht der Friedhof von Vöslau ein wenig anders aus, als ursprünglich geplant. Abgesehen davon, dass die räumliche Beschränkung schon damals nicht eingehalten werden konnte, wurde etwa die Todtengräber Wohnung – entgegen der Anweisung des k.k. Bezirksgerichtes – nicht über, sondern neben der Leichenkammer angelegt. Dahinter befindet sich ein Urnenhain und in dessen Nähe jene Gräber, die den Ehrenbürgern der Stadt vorbehalten sind.
Das Areal selbst musste aufgrund von Platzmangel immer wieder erweitert werden, sodass die heutige Gesamtfläche etwa das 4fache des einstigen Planes umfasst (20.000,031 m² / 2 ha). Der Friedhof besteht aus ca. 1.700 Erdgräbern, 88 Gruften, 120 Urnennischen und 60 Russengräbern.
Monumentale Gräber und Park-Charakter
Flaniert man durch den ursprünglichen Teil des Friedhofes, entdeckt man viele monumentale Gräber. Im späten 19. Jahrhundert entwickelten sich nämlich die Grabstätten zu Schauplätzen eines ausufernden Monumentalkultes. Die Stilformen der Grabmäler wurden immer vielfältiger. Insbesondere der Historismus des späten 19. Jahrhunderts trieb üppige Stilblüten: Neobarocke Formen standen neben neogotischen und neoklassizistischen. Für die Gräber wurden oft angesehene Architekten oder Baumeister beauftragt.
Der Friedhof Bad Vöslau besticht heute durch seinen Park-Charakter. Es dominieren sehr alte und hohe Thujenhecken sowie Buchsbäume. Letztere werden aufgrund des Buchsbaumzünslers sukzessive gegen robuste Sträucher getauscht. Ebenfalls ein Highlight sind mehrere alte Lindenbäume.
Am Gelände verteilt stehen etliche Parkbänke, die zum Verweilen einladen. Nur die Hauptwege sind asphaltiert. Der Friedhof Bad Vöslau ist übrigens ein Natur im Garten-Vorzeigeprojekt . Bei der Pflege wird auf chemische Unkrautbekämpfungsmittel gänzlich verzichtet.
„unter jedem Grabstein liegt eine Weltgeschichte“
Heinrich Heine
- Grab 2: Paul Gautsch Freiherr von Frankenthurn
- Grab 3: Anton Freiherr von Schönfeld
- Grab 4: Alexander Ritter von Koloswoski
- Grab 5: Dominik Brümmer
- Grab 6: Karl Lamac
- Grab 9: Vladimir Freiherr von Prazak
- Grab 17: Michael Zwierschütz
- Grab 19: Familie Schlumberger
- Grab 20: Theodor Emil Freiherr von Raule
- Neben Grab 415: Wilhelm Knaack
- Grab 24: Rosalie von Geymüller
- Grab 32: Familie Witzman
- Grab 43: Carl Ziegler
- Grab 46: Johann August Schneider
- Mausoleum: Ludwig Schneider
- Grab 71: Familie Kainrath
- Grab 75: Familie Josef Witzmann
- Grab 83: Ferdinand Piatnik
- Grab 84: Familie Reiter
- Grab 86: Ami Boue
Grab 2
Paul Gautsch Freiherr von Frankenthurn (1851-1918)
Der Studienfreund von Robert II. Schlumberger war auch Erbauer der Kaiser Franz Joseph-Schule.
1873 zog Gautsch nach Vöslau, um sich auf sein Doktorexamen vorzubereiten. Hier lernte er seine Frau Helene Schlumberger kennen. Mit 34 Jahren wurde er zum Minister für Unterricht und Cultus ernannt und eröffnete die Kaiser Franz Joseph-Schule (heutige Neue Mittelschule) in Vöslau.
Architekt Ludwig Baumann errichtete die späthistorische Gruft. Baumann zeigt sich auch verantwortlich für viele Bauten in Berndorf, sowie u.a. für das ehem. Kriegsministerium am Wiener Stubenring (heute Sitz des Wirtschafts- und Sozialministeriums).
Grab 3
Anton Freiherr von Schönfeld (1827-1898)
Carl Michael Ziehrer widmete ihm den Schönfeld-Marsch (Op. 422).
Seit 1880 kam Schönfeld immer wieder nach Vöslau und gerngesehener Gast im Thermalbad. Als hochrangiger Offizier der k.u.k. Armee war er Chef des Generalstabs (von 1876 bis 1881) und General-Truppen-Inspector (ab 1895). Anton Freiherr von Schönfeld starb am 7. Jänner 1898. Zu seinem Begräbnis in Wien kam sogar Kaiser Franz Joseph I. Auf Schönfelds Wunsch hin wurde er am Vöslauer Friedhof in eigener Gruft beigesetzt.
Der Name Schönfeld ist der Nachwelt aber auch musikalisch bekannt: Der Komponist Carl Michael Ziehrer, ebenfalls des Öfteren Kurgast in Bad Vöslau, widmete dem Freiherrn den Schönfeld-Marsch (Op. 422). Uraufführung dieses Marsches war am 16. Oktober 1890. Dazu gibt es eine besonders nette Anekdote von Willy Sommer, Mitglied der Deutschmeister-Regimentsmusik:
„Eines Tages, das Regiment war samt der Musik zu einer großen Übung ausgerückt, musste ich in der Kaserne Inspektion halten. Da kam der Zugführer Nemetz mit dem Befehl des Herrn Obersten, ich hätte mich sofort zu Ziehrer zu begeben, um ihm zu sagen, Exzellenz von Schönfeld hätte nach dem längst versprochen Marsch gefragt. Ich entledigte mich meiner Aufgabe, und Ziehrer sagte im ruhigsten Tone: „Jessas, auf den hab‘ ich ganz vergessen!“ Dann fügte er hinzu: „Aber warten’s a bisserl, Sommer, ich werd’n gleich haben!“ Er setzte sich ans Klavier, begann mit den ersten Takten, skizzierte je ein Thema, schrieb es auf ein Stück Notenpapier und gab es mir mit den Worten: „So, da hab’n S‘, fahr’n S‘ g’schwind in die Kasern‘ und sagsn S‘ dem Feldwebel Grohmann, er soll den Marsch sofort für Blech instrumentieren!“ So geschah es auch und der Freiherr von Schönfeld bekam seinen Marsch.“
Grab 4
Alexander Ritter von Klosowski (1839-1866)
Mit seiner Bestattung wurde der neue Friedhof eingeweiht.
Oberleutnant Klosowski erlitt am 11. Juli 1866 in der Schlacht bei Königgrätz (Krieg gegen Preußen) schwerste Verletzungen. Er kam in das Vöslauer Notspital, das der damalige Bgm. Robert I. Schlumberger einrichten ließ. Das geschah damals vielerorts, weil die Krankenhäuser die zahlreichen Verwundeten nicht aufnehmen konnten.
Klosowski starb am 4. August 1866 und wurde am 7. August begraben.
Grab 5
Dominik Brümmer (1831-1901)
Zu seinem Hauptwerk als gelernter Kunsttischler zählt die Einrichtung der Vöslauer Apotheke Zum Erlöser in der Hochstraße 25.
Dominik Brümmer wurde am 11. Jänner 1831 als Sohn des aus Norddeutschland zugewanderten Tischlers Ernst Brümmer geboren. Dieser war wegen einer Auftragsarbeit nach Vöslau gekommen und hatte sich hier niedergelassen. Nach der Tischlerlehre absolvierte er eine Ausbildung zum Kunsttischler und übernahm die väterliche Werkstatt in Vöslau. Zu seinem Hauptwerk zählt die Einrichtung der Vöslauer Apotheke Zum Erlöser.
Das Bürgermeisteramt schlug er mehrmals aus. Allerdings war Brümmer im Gemeinderat vertreten und initiierte auch viele Einrichtungen im Ort:
• Als Feuerkommissär (seit 1860) gründete er mit gleichgesinnten Männern 1865 die Freiwillige Feuerwehr Vöslau, deren einstimmig gewählter Hauptmann er 35 Jahre bis zu seinem Tode blieb.
• Dominik Brümmer ist der Begründer des ersten Ortsmuseums in Vöslau.
Grab 6
Karl Lamač (1896-1972)
Dank ihm kam das Wiener Riesenrad in seinen Familienbesitz.
Im Jahre 1897, anlässlich des 50. Thronjubiläums Kaiser Franz Josephs I., wurde das Wiener Riesenrad errichtet. Nach dem Ersten Weltkrieg war es im Besitz von Eduard Steiner, der jedoch von den Nationalsozialisten enteignet wurde und im KZ Ausschwitz ums Leben kam. Im Krieg brannte das Riesenrad aus, wurde fast gänzlich vernichtet und sollte abgerissen werden. Der aus Brünn stammende Rechtsanwalt Karl Lamač erkannte die Gefahr und kaufte scheibchenweise alle Anteile am Riesenrad auf. Seit 1961 ist das Wahrzeichen im Familienbesitz, ebenso wie die Villa in der Waldandachtstraße.
Grab 9
Vladimir Freiherr von Pražák (1852-1927)
Er heiratete – sehr überstürzt – eine Schlumberger.
Minister Alois Freiherr von Pražák verbrachte mit seiner Familie viel Zeit in Vöslau. Seine Frau Antonie starb während eines Kuraufenthaltes. Deren ältester Sohn Vladimir war ein hoher Beamter und arbeitete im selben Ministerium wie Paul Gautsch (siehe Grab 2, verheiratet mit Helene Schlumberger). Er heiratete 1893 Ida Schlumberger. Erst kurz davor wurde Verlobung gefeiert. Die überstürzte Hochzeit war wohl ein Versuch, Ida von ihrer Liebe zu ihrem Schwager Paul Gautsch zu „heilen“, in den sie unsterblich verliebt gewesen sein soll.
Grab 17
Michael Zwierschütz (1810-1872)
Er war der erste Vöslauer Bürgermeister, betrieb das Hotel Zwierschütz und gründete die erste Schule.
Während der Revolution 1848 war Zwierschütz Kommandant der Nationalgarde Vöslau. Wahrscheinlich war dies der Grund, warum er zum ersten Bürgermeister von Vöslau gewählt wurde. (1849 – 1855). Das erste Bürgermeisteramt befand sich im Hotel Communal in der Hochstraße. Zudem betrieb Zwierschütz das gleichnamige das Hotel Zwierschütz (heutige Volksbank) am Schlossplatz. Während seiner Amtszeit wurde das erste Schulhaus errichtet und am 25. Juli 1952 mit dem Unterricht begonnen. In dem Gebäude befinden sich heute das Stadtmuseum und die Stadtbücherei.
Grab 19
Familie Schlumberger
Von Vöslau nach Wien und London – Goldeck war und ist in aller Munde!
Robert Schlumberger, geboren 1814, wuchs in Stuttgart (DE) auf. Nach dem Tod seines Vaters musste er sein Studium abbrechen und arbeitete als Kaufmann in einer Champagner-Kellerei in Frankreich, wo er bis zum Kellermeister und Produktionsleiter aufstieg. Auf einer Rheinfahrt lernte er die Wienerin Sophie Kirchner, die Tochter eines Knopffabrikanten, kennen. Da ihre Eltern einer Übersiedlung nach Frankreich nicht zustimmten, zog Schlumberger 1842 nach Österreich um und heiratete Sophie. Sie hatten fünf Töchter und drei Söhne.
Mit dem Ziel, hier ebenfalls eine Sektkellerei zu eröffnen, pachtete er in Bad Vöslau Weingärten und im Maital das Försterhaus und den sogenannten Maitalkeller. Die Familie übersiedelte 1854 in das neu erbaute Weingut Goldeck. Der bekannte Architekt August Schwendenwein hatte es geplant.
Schlumberger spezialisierte sich auf Schaumweine, die er nach der Methode der Champagne erzeugte. Er brachte so in Österreich den ersten weißen Schaumwein auf den Markt.
Seine Weine erhielten bereits 1845 Auszeichnungen, u.a. in London. So kam der Vöslauer Sparkling auch auf die Weinkarte der britischen Königin Victoria. In Wien wurde Schlumberger zum k.u.k. Hoflieferanten. Mit dem Vöslauer Goldeck wurde auch eine Cuvée zum Markenschutz angemeldet. Sie gilt als die älteste Weinmarke Österreichs.
Robert Schlumberger war von 1864-70 Bürgermeister in Vöslau. Ein Jahr vor seinem Tod wurde er noch als Edler von Goldeck in den Adelsstand erhoben. Nach seinem Ableben wurde das Unternehmen als offene Handelsgesellschaft auf seine drei Söhne Otto, Gustav und Robert II. aufgeteilt.
Die Sektkellerei Schlumberger in Wien und das Weingut in Vöslau gehören heute der Schweizer Holdinggesellschaft Sastre SA.
Grab 20
Theodor Emil Freiherr von Raule (1830-1884)
Der zweifache Vöslauer Bürgermeister erwarb einst den Emilienhof.
Theodor Emil Freiherr von Raule wurde am 20. April 1830 in Wien geboren. Der Jurist war bis 1866 im Staatsdienst tätig. Danach trat er als Realitätenbesitzer und war Vorstand in verschiedenen Organisationen. In Vöslau erwarb er den Emilienhof (heutiges Café Post), wo er und seine Familie lange Zeit die Sommer verbrachten. Zweimal war er als Bürgermeister des Kurortes tätig: 1870-73 und 1876-79. In dieser Position lagen ihm das Gedeihen und Aufblühen des Ortes sehr am Herzen. So erteilte er 1868 der drei Jahre zuvor gegründeten Feuerwehr die Ermächtigung, auf seine Rechnung eine passende Spritze anzukaufen. Auch widmete er der hiesigen Kurkapelle des Öfteren neue Walzer und Theaterstücke aus eigener Feder. Theodor von Raule wurde am 30. Mai 1861 in den österreichischen Freiherrnstand aufgenommen. Er starb am 10. Jänner 1884 in Wien, wurde aber in der Vöslauer Familiengruft beigesetzt. Raule zu Ehren wurde jene Straße nach ihm benannt, in welcher das alte Feuerwehrhaus steht.
neben grab 415
Wilhelm Knaack (1829-1894)
Der Schauspiel-Star war häufig Gast in Vöslau: In den Jahren 1874-85 sind elf Aufenthalte nachgewiesen.
Der in Rostock (DE) geborene Wilhelm Knaack war oft gesehener Gast der Kurstadt. Seit dem Jahre 1878 waren hierfür auch familiäre Gründe maßgebend, da seine Tochter Justine Gustav Schlumberger geheiratet hatte. Knaack war ein Star des Wiener Volksschauspiels und des ehemaligen Carl-Theaters. Er starb am 29. Oktober 1894. Seine letzte Ruhe fand er am Friedhof von Vöslau.
Grab 24
Rosalie Freiin von Geymüller (1785-1834)
Die Frau des Kammgarnfabrik-Besitzers war für ihre Exzentrik und den verschwenderischen Lebensstil berüchtigt.
1833 gründete der Schweizer Bankier Johann Heinrich von Geymüller mit seinen Partnern Carl Deahna und Emil Rhode die Vöslauer Kammgarnfabrik. Keine zehn Jahre später ging das Bankhaus in Konkurs, Geymüller verließ Wien und verstarb als einfacher Handelsangestellter in Basel (CH). Verheiratet war er mit Rosalie Deahna.
Sie war vor ihrer Heirat Gouvernante bei Graf Fries,
wo Geymüller sie auch kennengelernt haben soll.
Der Dichter Ignaz Castelli berichtet über sie Folgendes:
„Sie war schön und üppig gebaut, aber ein wahres Compositum von Launen aller Art.”
Ihr ausschweifender Lebensstil war an der finanziellen Lage Geymüllers wohl nicht ganz unschuldig. Dass es sich bei Rosalie zweifelsfrei um eine exzentrische Person gehandelt haben muss, belegte auch Schriftstellerin Hermine Cloeter:
„Draußen auf ihrem Gute in Vöslau, wohin man die Schwerkranke gebracht hatte, ließ sie sich, um gleichsam eine Generalprobe des Todes abzuhalten, in ihre Familiengruft legen. Sie wollte sehen und es erleben […] wie ihr der Tod zu Gesicht stand.”
Grab 32
Familie Johann Witzmann
Es gibt zwei große Gräber Witzmann hier am Friedhof – beide waren Realitätenbesitzer und beide betrieben ein Hotel (siehe auch Grab 75). Johann Witzmann betrieb in der Bahnstraße das Hotel Witzmann (heutiger Vöslauerhof). Eine Werbeeinschaltung aus der damaligen Zeit lautete: Johann Witzmann, anerkannt vorzügliche Restauration und Cafe in unmittelbarer Nähe der Bahn und des Bades. Billige Preise, aufmerksame Bedinung. […] comfortable Zimmer per Tag und Monat, sowie auch complet eingerichtete Wohnungen für die ganze Saison. [sic!]
Grab 43
Carl Ziegler (1843-1904)
Der Verkaufsdirektor der Fa. Schlumberger gründete auch die Freiwillige Feuerwehr Bad Vöslau.
Geboren am 6. Dezember 1843 in Konstanz (DE), wuchs Carl Ziegler nach dem frühen Tod seines Vaters bei seinem Onkel Robert I. Schlumberger in Vöslau auf. Nach einigen Jahren der Ausbildung im Ausland führte ihn Schlumberger in den Familienbetrieb ein. Bis zu seinem Tod am 29. Dezember 1904 leitete Carl Ziegler die Fa. Schlumberger. Ziegler war zudem im Gemeinderat vertreten und Mitglied in zahlreichen Vereinen und Organisationen, wie etwa dem Ortsschulrat oder dem Verschönerungsverein Vöslau. Im Besonderen jedoch engagierte er sich bei der Feuerwehr. Er gehörte zu den Gründungsmitgliedern und war jahrelang Hauptmann-Stellvertreter.
Grab 46
Johann August Schneider (1814-1897)
Nach dem Tod des Ehrenbürgers profitierte vor allem die Familie Schlumberger.
Der Sohn eines Schreinermeisters aus Markbreit/Main (DE) kam 1833 auf der Walz nach Wien. Nach zwei fehlgeschlagenen Versuchen machte er sich dort mit einer Weinschank selbständig. Er verlegte sich dann jedoch zunehmend auf den Weinhandel und verdiente damit viel Geld. So konnte er sich 1852 in Vöslau Weingärten und 1869 ein Grundstück kaufen, auf dem er die Augustenvilla errichtete. 1872 erwarb er vom Grafen Mottet erwarb er die Marienvilla samt Weingärten. Ein Jahr zuvor zog die Fam. Schneider gänzlich nach Vöslau. Schneider wurde wegen seiner Verdienste um Vöslau und seiner karitativen Werke zum Ehrenbürger ernannt.
Seine Tochter Emma heiratete im Jahr 1872 Otto I. Schlumberger, den ältesten Sohn von Robert I. Damit gingen nach August Schneiders Tod am 7. Juli 1897 sämtliche Grundstücke in den Besitz der Fam. Schlumberger über.
Mausoleum
Ludwig Schneider (1835-1913) und Olga Waissnix (1862-1897)
Südbahnwirt Ludwig Schneider verdiente mit seinem Restaurant ein kleines Vermögen. Seine Tochter Olga war die platonische Nicht-Geliebte von Arthur Schnitzler.
Der Weinlieferant und Gastwirt Ludwig Schneider besaß in Wien eine Weinhandlung und ein Gasthaus. Er pachtete Mitte des 19. Jahrhunderts das Restaurant im neuen Bahnhof der Wien-Raaber Eisenbahn (später Südbahn). Die Wiener stürmten, trotz der teuren Fahrkarten, die Südbahn. Der Schneider’sche Betrieb florierte so ausgezeichnet, dass Schneider sich von Architekt August Krumholz eine schlossähnliche Villa in der Ludwigstraße im Stile des Historismus entwerfen ließ: die Villa Stillfried (ugs. Haugwitzschlößl, heutige Villa Weinfried).
Die Tochter des „Südbahnwirten“ war Olga Waissnix. Seine Tochter Olga war – unglücklich – verheiratet mit Carl Waissnix, Besitzer des berühmten Thalhofes bei Reichenau/Rax. Eine gewisse Berühmtheit erlangte sie durch ihre Nicht-Affäre mit Arthur Schnitzler. Beide kannten sich aus Kindheitstagen: Sie hatten in Vöslau (Arthur Schnitzlers Onkel besaß zwei Villen) zusammen gespielt – und sich „geprügelt“ (Erinnerungen von Arthur Schnitzler). Die platonische Beziehung begann bei einer zufälligen Begegnung in Meran (IT), flaute zwischenzeitlich ab, wurde aber gegen Ende von Olgas kurzem Leben wieder intensiver. Sie starb am 4. November 1897 im Alter von 35 Jahren.
Das vom mehrfach ausgezeichneten Architekten Johann Nepomuk Scheringer im byzantisch-orientalisierenden Stil errichtete Mausoleum der Familie Schneider entstand um 1880.
Grab 71
Familie Kainrath
Anton Kainrath haben wir DAS Wahrzeichen von Bad Vöslau zu verdanken: den Harzbergturm. Eröffnet wurde dieser am 10. Juli 1898 anlässlich des 50. Regierungsjubiläums Kaiser Franz Josephs I 1897.
Grab 75
Familie Josef Witzmann
Der Realitätenbesitzer schuf die Basis für das heutige Hotel Stefanie.
Der Kottingbrunner Josef Witzmann besaß am Ende seines Lebens insgesamt 21 Realitäten, unter anderem auch jenes Grundstück, auf dem 1896 das Hotel Stefanie erbaut wurde. Er selbst hat den Bau des Hotels nicht erlebt. Seine Witwe Therese Witzmann errichtete sechs Jahre nach Josefs Tod das Hotel Stefanie. Zu diesem Zeitpunkt war sie bereits 65 Jahre alt. Benannt wurde das Hotel nach der Kronprinzessin Stephanie, der Ehefrau Kronprinz Rudolfs. Das Hotel ist seit Beginn an in Familienbesitz und feierte unlängst seinen 120. Geburtstag.
Grab 83
Ferdinand Piatnik (1819-1885)
Der ungarische Kartenmaler gründete das heutige Spieleimperium Piatnik.
Der in Ofen (HU) geborene Piatnik erlernte den Beruf des Kartenmalers und kam auf der Walz nach Wien. Dort fand er in Anton Mosers Kartenmalerei-Betrieb eine Anstellung und übernahm die Firma nach dessen Tod. Piatnik stellte von der veralteten händischen Herstellung und Kolorierung der Karten auf industrielle Produktion um. Eine Erfindung des Unternehmers – die Beschichtung der Karten mit einem Lacküberzug, um sie mit Wasser reinigen zu können – brachte ihm 1861 ein Patent ein, das mehrmals verlängert wurde. Das Unternehmen war nicht nur wirtschaftlich erfolgreich, sondern erwies sich auch als stilbildend: Piatniks Tarockkarten oder die französischen Schnapskarten sind heute weit über die Grenzen Österreichs hinaus bekannt. Noch beliebter sind die Doppeldeutschen Schnapskarten mit Motiven aus Schillers Wilhelm Tell. Das „Pferd“ am Herz AS stammt übrigens von der Leidenschaft zu Galopprennpferden.
Seine Arbeit wird von seinen Nachkommen erfolgreich fortgesetzt: Heute ist der Verlag ein führender Anbieter von Spielen in ganz Europa. Ferdinand Piatnik starb 1885 in Vöslau und liegt nun hier am Friedhof begraben. Das Grab wird nach wie vor von Familie Piatnik persönlich gepflegt.
Grab 84
Familie Reiter
Die politisch engagierte Familie ist für zahlreiche berühmte Bauten Vöslaus verantwortlich.
Florian Reiter wurde 1814 geboren. Seit dem Jahr 1846 lebte er in Vöslau. Zu seinen bedeutendsten Bauten zählen das ehem. Spital in der Sooßerstraße (heutiges Jakobusheim) und die alte evangelische Kirche. 25 Jahre lang, bis zu seinem Todestag, war er Mitglied des Gemeinderats. Reiter und seine Frau Marie Betty Fritschner hatten vier Kinder. Der älteste Sohn Rudolf, geboren 1853, erlangte noch größere Bedeutung für Vöslau: Rudolf Reiter wurde am 2. April 1853 geboren, besuchte die die Technische Hochschule unter Professor Ferstl und anschließend die Akademie unter Professor Hansen. 1886, nach dem Tod seines Vaters, übernimmt er dessen Geschäft in Vöslau. Zwei Jahre später wird er in den Gemeinderat berufen und 1902 zum Bürgermeister gewählt. In seine Amtszeit fallen die Erhebung Vöslaus zum Curort (1904) und die Erschaffung des Elektrizitätswerkes. Seine wichtigsten Bauten sind der Kursalon (1880), die Hauptschule(1893), sowie zahlreiche Villen, etwa in der Jägermayerstraße, Raulestraße und der nach ihm benannten Rudolf Reiter-Straße. Rudolf Reiter starb am 10. Oktober 1925.
Grab 86
Ami Boué (1794-1881)
Der Erdwissenschaftler war der Erste, der den geologischen Aufbau des Wiener Beckens exakt beschrieb. Zudem verfasste er einige Studien über die Vöslauer Thermalquelle.
Ami Boué war der Abstammung nach Franzose und wurde in Hamburg (DE) geboren. Er lebte einige Jahrzehnte in der Vöslauer Villa Boué (heutige Villa Daphne) beim Kurpark und starb am 21. November 1881 nach langer Krankheit in Wien, im hohen Alter von 87 Jahren. Berühmt geworden ist er als Geologe. Er war der erste Gelehrte, der den geologischen Aufbau des Wiener Beckens exakt beschrieb. Zudem verfasste er einige Studien über die Vöslauer Thermalquelle.
In seinem Testament steht folgender bemerkenswerter Passus:
Ich wünsche nur eine sehr einfache Beerdigung, Ich brauche den Luxus der Pompes funèbres nicht, aber ich bitte um die Öffnung meines Brustkastens durch Dr. Förster, welcher mir als längjähriger Freund und Wohltäter diesen Dienst nicht versagen wird, damit ich dem schreckliche Wiedererwachen in der Gruft gewiß entgehe. Ich bitte ihn tausendmal, bitte darum!! Ich wünsche bei meiner Leiche keine Begleitung meiner akademischen Collegen. Ich will ihnen einen Schnupfen ersparen. Wenn ich in Wien begraben werde, ist es etwas Anderes. Aber in Vöslau, bei der weiten Entfernung des Gottesackers, ist die Begleitung eine Belästigung.