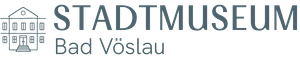Mehr Informationen zu den einzelnen Stationen
1. Maria Immaculata
Die neugotische Maria Immaculata Skulptur an der Rathaus-Fassade ist viel mehr als nur eine Heiligenfigur: Sie steht für eine neue religiöse Ära
Die Maria Immaculata Skulptur an der rechten Gebäudefassade des Rathauses stammt aus der Neugotik (18./19. Jh.) Marienfiguren oder Heiligenfiguren sind an sich nichts Außergewöhnliches. In diesem Fall steckt aber eine Geschichte dahinter, beziehungsweise eine „Glaubensfrage“: Im Jahr 1761 kaufte der Schweizer Handelsmann Johann Graf von Fries die Herrschaft Vöslau. Johann war calvinistischen Glaubens. Als er in Vöslau herrschte, gab es daher keine katholische Kirche, geschweige denn eine Marienfigur an einer seiner Fassaden
Der Calvinismus ist eine (strenge) religiöse Glaubenslehre innerhalb des Protestantismus, gegründet vom Franzosen Johanes Calvin. Die Theologie Calvins betont die unbedingte Heiligkeit Gottes. Alles Menschenwerk, der Kultus der katholischen Kirche mit Sakramenten und Reliquien galten als Versuche, die Souveränität Gottes einzuschränken.
Am 29.8.1764 heiratete Fries die Französin Anne d’Escherny, die aus einer reichen Hugenottenfamilie stammte, in Paris. Am 7.9.1765 wurde Annes und Johanns erster Sohn, Franz Josef Johannes, geboren und am selben Tag in der Stephanskirche „reformiert“ getauft. Taufpaten waren Kaiserin Maria Theresia und Kaiser Joseph II., vertreten durch den kaiserlichen Obristen Joannis von Krempel. Das war ein seltener Ausdruck der Wertschätzung der Monarchen für einen verdienten Calvinisten. Noch erstaunlicher ist die Taufe des Kindes eines Calvinisten im Wiener Stephansdom.
Johanns Enkelsohn Moritz II. heiratete die vermögende Flora von Pereira-Arnstein. Floras Eltern waren die berühmte Salonniére Henriette von Arnstein und der Bankier Heinrich Freiherr von Pereira. Das Ehepaar Pereira-Arnstein konvertierte vom Judentum zum katholischen Glauben. Flora wuchs also als strenge Katholikin auf. Der Liebe wegen konvertierte Moritz II. rund um 1850 zum Katholizismus. Fünf Jahre später platzierte die Familie Fries die Maria Immaculata als Zeichen der neuen religiösen Gesinnung an der Schlossfassade.
2. Mammuts im Schlosspark
Ob einst echte Mammuts durch den Schlosspark flaniert sind, ist nicht bewiesen. Aber es gibt sehr wohl die pflanzlichen Vertreter!
Im Schlossparks befinden sich einige mächtige Mammutbäume: Aufmerksame entdecken den Riesenmammutbaum (Sequoiadendron giganteum) und den Urweltmammutbaum (Metasequoia glyptostroboides).
Der Riesenmammutbaum ist ein immergrüner Nadelbaum, meist mit einer hohen, schmalen Krone. Als größte Pflanze der Erde ist der Riesenmammutbaum auch eine der ältesten und schwersten. Das größte Exemplar, der „General Sherman Tree“, misst knapp 84m (mit einem Durchmesser von ca. 9,95m) und befindet sich im Sequoia-Nationalpark (Sierra Nevada, Kalifornien/USA). Die Sierra Nevada gilt auch als die ursprüngliche Heimat dieses Baumes. Seit Mitte des 19. Jh. werden diese Bäume auch in Mitteleuropa gepflanzt.
Als Dinosaurier unter den Bäumen gilt der wesentlich kleinere sommergrüne Urweltmammutbaum: Er wird nur etwa 30m hoch. Allerdings hat er die spannendere Geschichte: Er galt lange Zeit als ausgestorben, wurde aber im Jahr 1941 wiederentdeckt. Zu dieser Zeit wurde besagter Baum anhand von Versteinerungen wissenschaftlich beschrieben und so – eher zufällig – in China (Regionen Sichaun und Hubei) aufgespürt. Daher ist er auch unter dem Trivialnamen Chinesisches Rotholz bekannt, nicht zuletzt weil seine Rinde rötlich schimmert. In seiner ursprünglichen Form kommt er nur noch in kleinen Populationen in China vor. Seit seiner Entdeck
3. Mörderischer Schlossteich
Kaum zu glauben, dass sich in diesem friedlichen Gewässer einst grausame Szenen abspielten
Wenn man heutzutage die putzigen Entenfamilien im Schlossteich beobachtet, kann man gar nicht glauben, dass sich hier einst grausame Szenen abgespielt haben! Im 18. Jh. war der Schlossteich nicht knie- oder hüfttief wie heute, sondern vergleichsweise riesig und vor allem tief. Man konnte darin sogar Boot fahren! Auf Grund der Tiefe und der Tatsache, dass im 18. Jh. nicht jeder die Kunst des Schwimmens beherrschte, kam es zu einigen tragischen Unfällen:
Im Jahr 1773 kenterte Johann Baptist Edler von Mayer im Schlossteich. Er und der zu Hilfe eilende Wirt Simon Häberl Würth ertranken beide qualvoll. Der Verunglückte war der Sohn des Hofrates und Kammerzahlmeisters Johann Adam von Mayer, der am Hof Maria Theresias eine besondere Vertrauensstellung innehatte. Mayer und Würth wurden beide in der Pfarrkirche Gainfarn beigesetzt. Eine dort angebrachte Grabtafel zeugt noch heute von dem Unglück.
Zwölf Jahre danach kam es zu einem weiteren Todesfall im Schlossteich: Graf Johann von Fries, der Besitzer der Herrschaft Vöslau, ertrank hier im Jahre 1785 mit 66 Jahren. Sein unerwarteter Tod gab viele Rätsel auf. Verschiedene mögliche Todesursachen waren im Umlauf: Die erste Version sprach vom Selbstmord des angeblich depressiven Grafen. Auch ein Art Abschiedsbrief wurde gefunden, der diese Version untermauerte. Andere Zeitgenossen hielten ein Unglück für wahrscheinlicher: Der Graf könnte bei einem nächtlichen Spaziergang in den Teich gestürzt und dort ertrunken sein. Die dritte Annahme war wohl die abenteuerlichste: Graf Fries hätte sich zu „alchemistischen Torheiten“ verleiten lassen, einen Großteil seines Vermögens in Transmutations-Experimente vergeudet und in Verzweiflung darüber den „furchtbaren Sprung ins Jenseits getan“. Fries‘ Tod wird wohl ein Rätsel bleiben.
4. Der Heilige Nepomuk
Die Sandsteinplastik des Heiligen Johann Nepomuk aus dem dritten Viertel des 18. Jh. ist nicht mehr ganz vollständig
Die Sandsteinplastik vom Heiligen Johann Nepomuk aus dem dritten Viertel des 18. Jahrhunderts stand nicht immer beim Schlossteich. Ursprünglich befand sie sich bei der ehemaligen Rossschwemme in der Gegend Wiener Neustädter-Straße. Hierher in den Schlosspark passt sie aber auch gut, denn Nepomuk-Plastiken findet man oft an Wasserläufen oder Brücken. Nepomuk gilt nämlich als Brückenheiliger, sowie Patron des Beichtgeheimnisses. Unser Exemplar steht auf einem mit einer Rocaille (Muschelwerk) verzierten Sockel. Zu seinen Füßen befinden sich zwei possierliche Engelsköpfchen.
Nepomuk lebte im 14. Jahrhundert und war ein Mann der Kirche. Auf Grund eines kirchenpolitischen Streits wurde er im Namen des in Prag regierenden Königs Wenzel von der Karlsbrücke in die Moldau gestürzt und ertränkt. Die Leiche soll der Legende nach von fünf Flammen umgeben gewesen sein, weswegen Johannes Nepomuk oft mit fünf Sternen um sein Haupt abgebildet wird.
Eine andere Legende besagt, dass der fromme Nepomuk zu seinen Lebzeiten auch der Beichtvater von Euphemia von Bayern, der Gattin König Wenzels, gewesen sein soll. Diese war für ihre Schönheit bekannt. Ironischerweise lebte der notorische Fremdgeher Wenzel in der ständigen Angst, dass seine anmutige Gemahlin ihn betrügen könnte. Als er schließlich erfuhr, dass diese sich überaus häufig bei Nepomuk zum Beichten einfand, erwachte in ihm eine rasende Eifersucht, da er dachte, die hohe Beichtfrequenz stünde mit einer Vielzahl von Seitensprüngen in Zusammenhang. Nepomuk wurde vor den König zitiert. Doch trotz vielfachen Bedrängens Wenzels blieb Nepomuk standhaft und verriet das Beichtgeheimnis nicht. Da er ihm partout nichts entlocken konnte, nahm er den verschwiegenen Kleriker gefangen, folterte ihn eigenhändig mit Pechfackeln und ertränkte ihn schließlich in der Moldau.
Aufmerksamen Nepomuk-Spezialisten fällt auf, dass einige typische Attribute bei der Skulptur im Vöslauer Schlosspark nicht vorhanden sind, zum Beispiel das Kreuz in der linken Hand. Ebenfalls abgängig ist der typische Kranz mit fünf Sternen um seinen Kopf. Warum beides bei unseren Nepomuk fehlt, bleibt wohl ein Mysterium.
5. Die unscheinbare Bodenskulptur
Skulpturen gibt es im Schlosspark viele. Aber leicht zu entdecken ist diese hier nicht
Der Schlosspark ist voller Skulpturen aus verschiedensten Epochen. Während einige, wie die vom Heiligen Nepomuk (Station 4), eher älteren Semesters sind, muten andere Plastiken sehr modern an. Letztere stammen fast ausschließlich von Künstlern des Symposion Lindabrunn, einer Bildhauerzusammenkunft mit Sitz im benachbarten Enzesfeld-Lindabrunn. Gegründet wurde es auf Initiative des Vöslauer Bildhauers Mathias Hietz, dem Erschaffer des Freiheitsbrunnens vor dem Thermalbad und des „Pferdes“ in der Wiener Neustädter-Straße.
Im Jahr 1993 gestaltete eine neunköpfige internationale Künstler-Gruppe des Symposion Lindabrunn den kompletten Schlosspark zum Thema „Wasser“. Einige Skulpturen sind danach im Schlosspark verblieben.
Diese ist wohl die unscheinbarste Figur bzw. diejenige, die einem nicht sofort ins Auge sticht. Sie nennt sich „Boden und Wasser 1+2“ und stammt von dem Österreicher Georg Miks und dem Japaner Kenichi Mashita.
6. Die Spott-Vasen
Die vier Steinvasen des berühmten österreichischen Bildhauers Franz Anton Zauner landeten eher zufällig im Schlosspark
Ursprünglich standen sie vor dem Fries’schen Palais Pallavicini am Wiener Josefsplatz Nr. 5. Es hatte seinerzeit die erste rein klassizistische Hausfront und bescherte sowohl dem Besitzer Graf Johann von Fries als auch dem Star-Architekten Johann Ferdinand Hetzendorf von Hohenberg heftige Kritik. Man könnte sogar von einem regelrechten Architekturskandal sprechen.
Immens verspottet wurden vor allem die vier Steinvasen, die an der Fassade angebracht waren: Als „pot de madame“ bzw. „pot de monsieur“ betitelt, gingen die Nachttöpfe in die Schmähgeschichte Wiens ein. Schließlich wurden die Zauner-Vasen entfernt und fanden in Vöslau eine neue und wohl auch wertschätzendere Heimat.
Franz Anton Zauner schuf die Vasen im Jahr 1783/1784. Jede Steinvase zeigt einen anderen Erdteil, symbolisch dargestellt durch typische Flüsse und Tiere. Die Afrika-Vase zeigt den Nil, eine Sphinx, einen Löwen, eine Pyramide und Palmen. Auf der (Süd)Amerika-Vase sind der Rio de la Plata und ein Krokodil zu sehen. Auf der Europa-Vase zeigt sind die Donau und ein Pferd dargestellt. Die Indien-Vase zeigt den Ganges und einen Kameltreiber. Eine Australien-Vase wird man vergeblich suchen: Sie wurde nie erschaffen. Australien wurde zum damaligen Zeitpunkt nicht als eigener Kontinent betrachtet.
Die Vasen wurden nach dem Zweiten Weltkrieg (während der russischen Besatzung) zerstört und nach jahrelanger Deponierung vom Bundesdenkmalamt restauriert und neu aufgestellt. Ursprünglich standen die Vasen auf der Nordseite des Schlossparks, an der Edgar Penzig Franz-Straße. Nun sind die rund um ein Rondeau angesiedelt und werden in der Nacht stimmungsvoll beleuchtet.
7. Die Zacken-skulptur
Zackenfigur, Dornenkrone, Kaktus – wohl kaum eine Figur gibt ob ihrer Optik mehr Rätsel auf
Geschaffen wurde die steinerne Skulptur vom deutschen Bildhauer Arthur Gläsner. Sie trägt den Titel „Kastanie“ und war noch vor einigen Jahren die erstplatzierte stachelige Vertreterin einer langen Allee ebendieser Bäume: Eine lange Kastanienallee führte von der Edgar Penzig Franz-Straße bishin zum Schloss.
Der Rosskastanienminiermotte ist es zu verdanken, dass nun eine neugepflanzte Lindenallee den Weg bis zum Schloss flankiert und nur noch wenige „echte“ Kastanien im Schlosspark verblieben sind.
8. Das verschwundene Denkmal
Die heutige Pestkapelle bei den markanten Schirmföhren stand nicht immer hier im Schlosspark. Sie wurde erst 1955 hierher versetzt. Zuvor stand an dieser Stelle der „Tempel der Unsterblichkeit“.
Die Pestkapelle wurde 1955in den Schlosspark versetzt. Es handelt sich dabei um ein Bauwerk aus dem Jahr 1713. Das Altarbild im Inneren der Kapelle stammt vom ortsansässigen August Scheiner und erinnert an das Pestjahr 1713. Unter dem Altarbild befindet sich eine Steinplastik der Pestheiligen Rosalia.
An der Stelle der heutigen Pestkapelle befand sich früher die Gruft der Grafen Fries samt eines Grabdenkmals aus teurem Carrara-Marmor. Das Denkmal wurde Ende des 18. Jh. vom Bildhauer Franz Anton Zauner geschaffen. Das Gesamtkunstwerk nannte sich „Tempel der Unsterblichkeit“.
Das Grabdenkmal zeigte eine lebensgroße Figurengruppe und stand auf einem Sockel aus steirischem Marmor: Fries der Vater, wie er seinem Erstgeborenen die Hand auf die Schulter legt und der Unsterblichkeit entgegen führte.
Die Fries’schen Gebeine brachte man in späterer Folge in die Familiengruft unter der heutigen Stadtpfarrkirche Bad Vöslau. Das Denkmal landete zunächst in einem kleinen „Tempelchen“ nach dem Entwurf von Star-Architekt Theophil Hansen. Es befand sich an der ehemaligen Schlossmauer nahe des heutigen Schneckenreservats. Danach wurde das Denkmal unter Schlosseigentümer Moritz Ritter von Gutmann restauriert und in den Gartenpavillon im südlichen Teil des Parks gebracht. Hierbei handelte es sich um den letzten bekannten Aufstellungsort des Denkmals.
Rund um 1945 verlor sich seine Spur und es gilt seither als verschollen. Ob nun zerstört oder gestohlen – es wird wohl ein Geheimnis bleiben.
9. Die mächtige Platane
Wenn mancher die mächtige Platane inmitten des Vöslauer Schlossparks als monumental bezeichnet, ist das wohl keine Übertreibung
Der ahornblättrige Solitärbaum hat einen Stammumfang von stattlichen 5,49m und misst über 25m. Der sommergrüne Solitärbaum ist auf Grund seiner Einzelstellung besonders markant und das botanische Wahrzeichendes Vöslauer Schlossparks. Abends wird er stimmungsvoll beleuchtet.
Platanen wurden schon in der Bibel erwähnt (insgesamt fünf Mal) und galten im Altertum als die schönsten Bäume des Orients. Der Name Platane geht auf das griechische Wort πλατύς (platýs) zurück, das so viel wie „weit ausgebreitet“ bedeutet und auf die mächtigen Stämme und Kronen Bezug nimmt. Napoleon Bonaparte soll sie an den Landstraßen für die in den Krieg ziehenden Soldaten gepflanzt haben. Deshalb sind in Paris auch heute noch 40% aller Stadtbäume Platanen.
Die Platane kann ein hohes Alter von 1.000 Jahren erreichen; die Exemplare im Vöslauer Schlosspark sind rund 200 Jahre alt und wurden wohl unter Graf Johann Fries gesetzt. Botanisch auffallend ist vor allem, dass die Rinde nicht mitwächst und im Sommer unter lautem Knacken abgeworfen wird.
10. peace, please!
Eine kreative Brücke für den Frieden
2015 jährte sich zum 70. Mal das Ende des Zweiten Weltkrieges. Anlass genug, um nicht nur sinnbildhaft Brücken zu bauen, sondern tatsächlich eine zu errichten. Der Arbeitskreis „Z’sammleben“ schuf die Brücke der Begegnungen, auch Friedensbrücke genannt. Am Geländer sind Bilder und Collagen zum Thema Frieden angebracht.
Bertha von Suttner wird darauf ebenfalls thematisiert. Ihr Lebenslauf liest sich wie das Drehbuch eines Hollywood-Films: Bertha, Sprössling aus reichem Hause, wuchs als Adelige in Wien und Niederösterreich auf. Als Jugendliche lernte sie mehrere Sprachen, reiste viel. Suttners Mutter verprasste mit ihrer Spielsucht das gesamte Vermögen. Bertha entschied sich folglich, ihren Lebensunterhalt selbst zu verdienen, zunächst als Gouvernante in Wien, dann als Sekretärin für Alfred Nobel in Paris. Als Gouvernante arbeitete sie für den Industriellen Karl Freiherr von Suttner und verliebte sich in dessen jüngsten Sohn Arthur. Bertha und Arthur heirateten heimlich, gegen den Willen seiner Eltern. Daraufhin wurde Arthur Suttner von seinen Eltern enterbt. Das junge Paar zog in den Kaukasus. Bertha schlug sich als Sprachlehrerin durch, Arthur zeichnete Pläne und Tapetenmuster. Irgendwann widmeten sich beide dem Journalismus und kehrten 1885 gemeinsam nach Wien zurück. Es folgte die Versöhnung mit Arthurs Familie. Bertha widmete sich in Folge fast ausschließlich der Schreiberei und fokussierte sich auf das Thema „Frieden“. Mit ihrem Roman „Die Waffen nieder!“ (1889) und ihren friedenspolitischen Aktivitäten erreichte sie weltweit Bekanntheit. Im Anschluss an einen Kuraufenthalt in Vöslau unternahm sie ihre erste Amerikareise zum Friedenskongress in Boston. Die Reise wurde ein persönlicher Erfolg: Von Suttner hielt mehrere gut besuchte Vorträge und Präsident Franklin D. Roosevelt empfing sie schließlich sogar im Weißen Haus. Ein Jahr später (1905) erhielt Bertha von Suttner als erste Frau den Friedensnobelpreis. Tragisch ist, dass sie wenige Tage vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs, vor dem sie so gewarnt hat, starb.
11. Der Blauglockenbaum
Kaisers Liebling ist auch in unserem Schlosspark zu finden
Der Blauglockenbaum (Paulownia tomentosa) wird auch Kiribaum oder Kaiserbaum genannt. Wahrlich kaiserlich sind die duftenden und optisch beeindruckenden blau-violetten Glockenblüten, die im Frühling so manchen Parkgast zum Staunen bringen. Ursprünglich in Japan und China beheimatet, brachte der Würzburger Naturforscher, Arzt und Japanologe Philipp Franz von Siebold den Blauglockenbaum nach Europa. Siebold stand in niederländischen Diensten und taufte den Baum nach der niederländischen Kronprinzessin und späteren Königin Anna Pawlowna, Tochter des russischen Zaren Paul I.
Der Blauglockenbaum wurde zum Lieblingsbaum von Kaiser Franz Joseph I. Viele der Bäume im ehemaligen Kaisertum Österreich sind auf seinen Wunsch hin gepflanzt worden. Damit wäre auch geklärt, warum es in den Zentren der ehemaligen Monarchie, wie zum Beispiel in Baden oder Schönbrunn, so viele davon gibt.